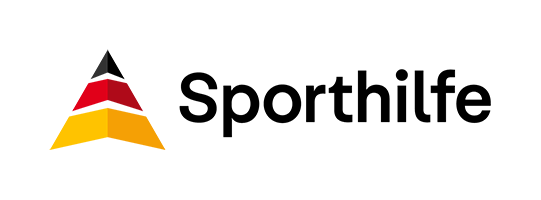
Skateboard-Pionier Titus Dittmann: „Skateboarden wird sich durch Olympia verändern“
Ex-Studienrat Titus Dittmann gilt als Skateboard-Pionier, er brachte die rollenden Bretter in den späten 1970er Jahren erst in den Schulunterricht und dann über sein Unternehmen „Titus“ auf die Straße. Bei den Olympischen Spielen in Tokio, die mittlerweile auf das Jahr 2021 verschoben wurden, wird „sein“ Sport nun erstmals olympisch – ein Gespräch über die Folgen und die pädagogisch-soziologische Kraft des Skateboardens.
Titus, Du hast kürzlich deinen 71. Geburtstag gefeiert. Wie oft stehst Du selbst noch auf dem Skateboard?
Das ist ein bisschen wetterabhängig, aber ich bemühe mich, jeden Samstag und Sonntag mit dem Skateboard zum Bäcker zu fahren – mein Lieblingstrick ist mittlerweile, auf dem Rückweg die Brötchen nicht zu verlieren. (lacht)
Alles andere wäre dem „Vater der deutschen Skateboard-Szene“ auch nicht würdig…
Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass ich das Skateboarden nach Deutschland geholt oder sogar erfunden habe. Aber sicherlich habe ich nicht nur die deutsche Szene geprägt, sondern durch mein Unternehmen „Titus“ (Online und Offline-Einzelhändler für Skateboard-Bedarf und Streetwear, Anm. d. Red.) und die Events, die wir veranstaltet haben, auch weltweit einen gewissen Einfluss genommen.

Wie bist Du damals in einer Zeit, als die Bundesregierung noch über ein Verbot der „gefährlichen Rollbretter“ nachdachte, zum Skateboarden gekommen?
Eigentlich erst, nachdem der erste Boom Mitte der 1970er Jahre vorüber war und das Interesse am Skateboard nachließ. Ich bin also sozusagen antizyklisch eingestiegen. Als angehender Sportlehrer sah ich in Münster die pubertierenden Rotzlöffel auf der Straße fahren und meine pädagogischen Antennen schlugen sofort aus. Da war kein Erwachsener dabei, kein Lehrer, keine Eltern und die konnten vom Lernen nicht genug kriegen. Das war das erste Mal, dass ich diese intrinsische Motivation erlebt habe und sah, was selbstbestimmtes Lernen mit Menschen machen kann. Ich habe mir mit 30 Jahren dann selbst ein Board besorgt und bin anfangs sehr oft auf die Schnauze gefallen. Als ich als Referendar ans Gymnasium kam, haben mich die Schüler, die mich vom Skateboarden her kannten, angesprochen und gefragt, ob ich nicht eine „Sportgemeinschaft“ organisieren könnte. Das Material habe ich aus den USA importiert, das war auch der Start für mein Unternehmen.
Das mit der Schul-AG hat offenbar geklappt.
Weil ich anscheinend schon mein ganzes Leben unbewusst immer sehr unternehmerisch und effizient gedacht habe. Beim Schulkollegium setzte ich durch, dass ich mein zweites Staatsexamen, damals noch eine wissenschaftliche Arbeit, über die Fragestellung schreiben durfte, inwieweit Skateboarden als Schulsport geeignet ist. Für die Hälfte meines Stundensolls „musste“ ich also Skateboard fahren. Für mich gab es natürlich nichts Geileres. Wohlgemerkt an einem althumanistischen Gymnasium, dessen Direktor mit allen Mitteln versuchte, das zu verhindern. Daran sieht man, was für eine Rebellion und Revolution das 1978 noch war. Mir hat das Lehrer-Dasein unheimlich viel Spaß gemacht, aber ich hatte ein Problem mit dem Korsett Schule und habe den Job später an den Nagel gehängt.
Ich muss zugeben, dass es mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, an den Normen zu kratzen.
Du warst auch in anderen, damals neuen Extrem-Sportarten wie Drachenfliegen und Snowboarden unterwegs, hast sogar an der ersten Snowboard-WM teilgenommen …
… 1986 in Aspen, Colorado. Ich habe da mitgemacht, obwohl ich vorher noch nie eine Schneehalfpipe gesehen hatte - schließlich war ich der einzige Snowboarder nördlich des Mains. Die Szene war also überschaubar. Wir hatten damals nur gerüchteweise gehört, dass es eine Weltmeisterschaft geben soll. Also flog ich mit einem Kumpel nach Colorado, ging dort einfach zur Registrierung und fragte, wer sich denn überhaupt anmelden dürfe. Als die Antwort lautete, aus jedem Land dürfen zwei Fahrer teilnehmen, haben wir einen Schritt nach vorne gemacht und gesagt: „Wir sind die deutsche Nationalmannschaft“. Beim Rennen war ich so lala, aber das Publikum hat getobt, weil ich der Älteste im Feld war. Heute würde ich mit meinem Können keine Dorfmeisterschaft gewinnen. Aber das war damals echtes Pioniertum!
Snowboarden hat sich extrem entwickelt und professionalisiert. Seit 1998 ist es olympisch, was die Szene gespalten hat. Das steht nun auch dem Skateboarden bevor. Wie siehst Du diese Entwicklung?
Ein Skateboarder sieht sich in erster Linie nicht als Sportler. Er würde von einem Lifestyle sprechen, von Lebensgefühl und Überzeugung.
Skateboarden ist gewissermaßen wie eine Religionsgemeinschaft, Ausdrucksmittel einer geistigen Haltung und eines Wertesystems.
Ich nenne es „ästhetische Gesinnungsgenossenschaft“ oder „bewegungsorientierte Jugendkultur“. In traditionellen Sportarten ist das anders, sie sind viel eher ein Querschnitt der Gesellschaft. Die Professionalisierung und die Aufnahme ins olympische Programm werden diese kulturelle Komponente des Skateboardens sicherlich verwässern.

Aber kann bewegungsorientierte Jugendkultur nicht auch Teil der Olympischen Spiele sein?
Jein. Der sportliche Aspekt spielte bei Skateboardern lange Zeit fast gar keine Rolle. Sie sind eine kleine Minderheit, das schweißt zusammen. Im Endeffekt tritt ein Skateboarder gegen sich selbst an. Es geht darum, Spaß zu haben. Leistung messen, klar, aber im positiven Sinn: Wenn einer einen Trick raushaut, den er noch nie gestanden hat, dann wird er dafür gefeiert, auch wenn er ansonsten kein so guter Fahrer ist. Das ist anders als etwa in der Leichtathletik. Da habe ich noch nie erlebt, dass die Zuschauer jubeln, weil einer im Weitsprung 1,30 Meter statt 1,10 Meter springt (lacht). Und Skateboarden ist als Teil der Jugendkultur ein Stück weit auch Rebellion. Bei allem Respekt vor den Athleten und ihrem Vorbildcharakter, aber: Niemand kann mir erzählen, dass ein Hammerwerfer ein Rebell ist. Skateboarden ist als Teil der Jugendkultur ein Stück weit auch Rebellion. Bei allem Respekt vor den Athleten: Ein Hammerwerfer ist kein Rebell.

Bedeutet Olympia also das Ende des Skateboard-Geistes?
In 50 Jahren wird es ein stinknormaler Sport ohne diese pädagogisch-soziale Power sein, also: Ja, für die Skateboard-Kultur bedeutet Olympia eine Änderung. Das gilt im Übrigen auch für andere selbstbestimmte Sportarten wie Parkour, Breakdance und BMX Freestyle. Aber es hat auch gute Seiten: Für diejenigen, die sich entscheiden, mit Skateboarden Geld zu verdienen, ist das natürlich geil. Bisher klappt das nur bis zu einem gewissen Level, aber Skateboarden ist so attraktiv, dank Olympia wird die Vermarktung durch die Decke gehen.
Wichtig ist aber, die richtige Balance zwischen Profitum und Werte-Kultur zu finden. Olympische Athleten sind immer auch Vorbilder für eine Gesellschaft.
Bedauerst Du diese Entwicklung?
Ich bin da Realist und erkenne den Lauf der Dinge. Alles hat seine Pionierzeit. Mir ist vollkommen klar: Olympia braucht Skateboarding. Das IOC braucht Einschaltquoten. Und wie bekommt man die? Mit den Produkten, auf die die Leute heiß sind. Deshalb ist damals auch Snowboarden olympisch geworden. Aber umgekehrt ist das anders: Skateboarden braucht Olympia nicht, ganz im Gegenteil. Skateboard wird jetzt Mainstream und Allgemeingut, daran kann man nichts ändern.
Verfolgst Du die deutschen Skateboarder, die sich für Tokio qualifizieren können?
Momentan liegt meine Priorität auf meiner Stiftung skate-aid, mit der ich mich aktuell um Kinder in Afghanistan und Syrien kümmere, die noch nie etwas mit Skateboarden zu tun hatten. Wir versuchen dort, die pädagogische Kraft des Skateboardens zu nutzen, so lange das noch geht. Aber klar, die meisten Fahrer kenne ich gut, eine meiner Tochterfirmen organisiert noch immer die Deutschen Meisterschaften. Ich bin also schon noch drin, aber mein Interesse liegt mehr auf der soziologischen und kulturellen Seite als auf der Leistung.
Wirst Du die olympischen Wettbewerbe trotzdem verfolgen?
Aber logo! Ich schaue das gerne. Ich gucke mir auch immer noch Skateboard-Videos an, aber ich muss sagen, seit das mehr in Richtung Leistung geht, werden die Clips fürchterlich langweilig und austauschbar. Ich kämpfe immer für die Balance, was in unserer Gesellschaft eher ungewöhnlich ist.
Ich verurteile Olympia nicht. Ich sage nur, Skateboarden wird sich verändern und dann hat jeder die freie Entscheidung, was er davon hält.
Wenn ein Deutscher bei Olympia eine Medaille holt, werden das viele total geil finden. Den Hardcore-Skatern wird es aber, sorry, am Allerwehrtesten vorbeigehen.

(Veröffentlicht am 16.04.2020)
Weitere Interviews










